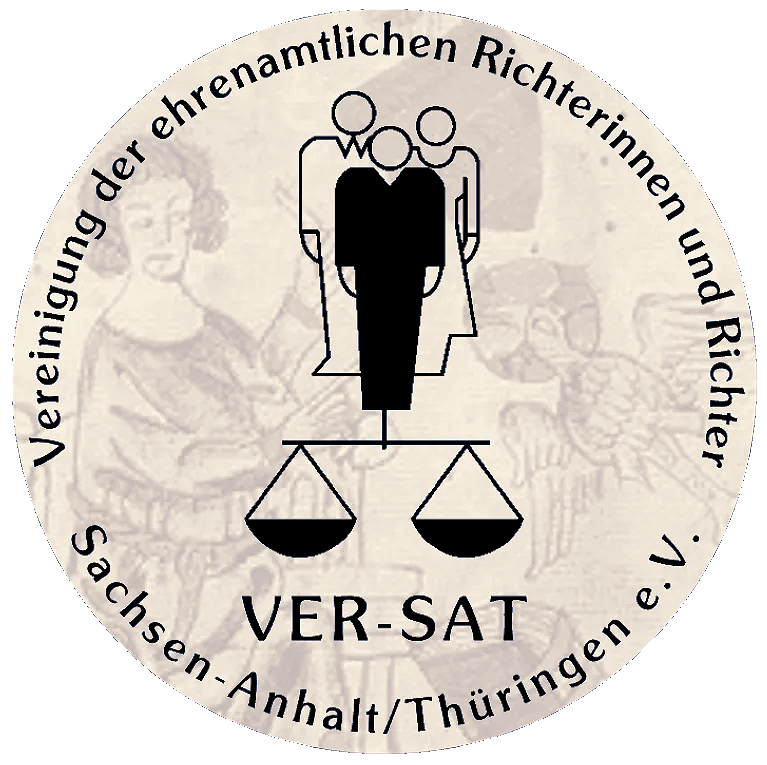„Vom Zellentürschlüssel zum Haustürschlüssel – Der andere Weg zurück ins Leben“
Können Sie sich vorstellen, dass ein verurteilter Straftäter morgens um 5:35 Uhr freiwillig zum Frühsport aufsteht? Dass er abends bei Tisch mit einer Familie sitzt und den kleinen Kindern beim Erzählen zuhört? Am 13. August 2025 durfte eine Gruppe interessierter Schöffinnen und Schöffen, auf Einladung von Paul Schneider, Leiter des Seehauses Leipzig genau das erleben.
Organisiert wurde dieser besondere Einblick in die freie Form des Strafvollzugs durch die Vereinigung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter – Sachsen-Anhalt/Thüringen e.V. (VER-SAT). Was wir an diesem idyllisch am See gelegenen Ort entdeckten, hat bei vielen Besuchern die Sicht auf den Strafvollzug nachhaltig verändert.
Ein Ort, der Hoffnung vermittelt
Das Seehaus Leipzig liegt malerisch direkt am Wasser in Neukieritzsch – eine Kulisse, die kaum gegensätzlicher zur grauen Realität herkömmlicher Justizvollzugsanstalten sein könnte. Hier, wo andere Urlaub machen würden, verbringen junge Straftäter zwischen 15 und 28 Jahren ihre Haftzeit auf völlig andere Weise. Statt Gitter und Mauern prägen Vertrauen und familiäre Strukturen den Alltag.
Das Konzept des „Strafvollzugs in freien Formen“ bietet eine revolutionäre dritte Alternative zum geschlossenen und offenen Jugendstrafvollzug. Bis zu 14 junge Männer leben hier in zwei Hauselternfamilien – jeweils sieben Bewohner mit einer Familie und deren eigenen Kindern zusammen. Was zunächst ungewöhnlich klingt, entpuppt sich als durchdachtes pädagogisches Konzept mit beeindruckender Wirkung.
Wenn der Tag um 5:35 Uhr beginnt
Der Tagesablauf im Seehaus ist straff durchstrukturiert und lässt wenig Raum für Leerlauf. Nach dem frühen Frühsport folgen Hausputz, Schule oder praktische Ausbildung, gemeinnützige Arbeit und abends gemeinsame Aktivitäten – bis zur Bettruhe um 22 Uhr. Diese 6-Tage-Woche mit Programm auch samstags fordert die jungen Männer konsequent heraus.
In der hauseigenen Berufsschule können die Teilnehmer ihren Hauptschulabschluss nachholen oder eine Ausbildung zum Ausbaufacharbeiter mit Schwerpunkt Zimmerei absolvieren. Drei Tage pro Woche arbeiten sie in den Ausbildungsbetrieben des Seehauses – in Tischlerei, Zimmerei/Bau oder Garten- und Landschaftsbau. Dabei übernehmen sie echte Verantwortung: Von der Kalkulation bis zur Rechnungsstellung können sie als Vorarbeiter fungieren und erleben, wie befriedigend ehrliche Arbeit sein kann.
Das Herzstück: Familie als heilende Kraft
Was das Seehaus wirklich besonders macht, ist das Familienprinzip. Die meisten jungen Männer haben nie erlebt, was funktionierende Familienstrukturen bedeuten. Hier lernen sie es am praktischen Vorbild: gemeinsame Mahlzeiten, Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der Kinder, Hilfe bei den Hausaufgaben.
Die Annahme in der Familie und die vertraute, verlässliche Beziehung zu den Hauseltern bildet die Basis für alle anderen Herausforderungen des Seehausalltags. Diese emotionale Sicherheit gibt den notwendigen Halt, auch Krisenzeiten zu überstehen – ein Fundament, das viele dieser jungen Männer nie zuvor erfahren haben.
Christliche Werte, überkonfessioneller Ansatz
Das Seehaus wurzelt in christlichen Grundwerten und arbeitet nach den Prinzipien der Diakonie, versteht sich aber als überkonfessionelle Einrichtung. Grundtugenden wie Ehrlichkeit, Ordnung, Höflichkeit und Selbstbeherrschung werden nicht nur gepredigt, sondern täglich vorgelebt. Die Mitarbeiter vermitteln durch ihr eigenes Verhalten, was Toleranz, Respekt und Verantwortung bedeuten.
Mehr als nur Strafe: Wiedergutmachung und Verantwortung
Ein zentraler Baustein des Konzepts ist die Auseinandersetzung mit den begangenen Straftaten. In Gruppengesprächen und Seminaren werden die jungen Männer mit der Opferperspektive konfrontiert. Sie lernen, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen und durch gemeinnützige Arbeit einen symbolischen Ausgleich gegenüber der Gesellschaft zu leisten.
Das Stufensystem motiviert zusätzlich: Durch Leistung und gutes Sozialverhalten können sich die Teilnehmer Privilegien erarbeiten. Wer sich bewährt, darf sogar auf externen Baustellen mitarbeiten und erlebt dabei die Anerkennung für handwerkliche Leistungen – oft das erste Mal in ihrem Leben.
Ein Konzept mit Potential – wenn man es nur ließe
Doch hier kommt der Wermutstropfen: Das Seehaus Leipzig hat Kapazität für 14 junge Männer, durchschnittlich sind aber nur die Hälfte der Plätze dort belegt. Der Grund? Es mangelt an Mut von behördlicher Seite, dieses bewährte Konzept des „Vollzugs in freien Formen“ konsequent zu nutzen. Zu groß ist offenbar die Sorge vor dem Risiko, zu gering das Vertrauen in die Wirksamkeit alternativer Vollzugsformen.
Dabei sprechen die Fakten eine andere Sprache: Das seit 2001 bestehende Konzept hat bereits vielen jungen Menschen den Weg in ein straffreies Leben geebnet. Die intensive Nachsorge mit ehrenamtlichen Paten, Begleitung durch hauptamtliche Mitarbeiter und Unterstützung bei Wohnungssuche und Arbeitsvermittlung sorgt dafür, dass der Übergang in die Freiheit gelingt.
Menschen, die über sich hinauswachsen
Was uns während unseres Besuchs am meisten beeindruckte, war das Engagement aller Beteiligten. Die Hauselternfamilien bringen einen enormen persönlichen Einsatz, leben rund um die Uhr mit den jungen Straftätern zusammen und schenken ihnen bedingungslos Vertrauen – einen Vertrauensvorschuss, der sich immer wieder auszahlt.
Die Mitarbeiter arbeiten mit einer Geduld und Hingabe, die bewundernswert ist. Sie sehen in jedem jungen Mann das Potenzial für eine positive Entwicklung und schaffen es, auch die verborgenen Stärken zu entdecken und zu fördern. Wer eine Clique zu Straftaten anstiften kann, hat schließlich auch das Zeug zum Anführer im positiven Sinne – es kommt nur darauf an, diese Fähigkeiten in die richtige Richtung zu lenken.
Harun* – Vom Aufbegehren zum Ankommen
Besonders eindrücklich war für viele der Besucher die Begegnung mit Harun* (Name geändert), einem ehemaligen Bewohner des Seehauses. Neben Herrn Schneider schilderte er ohne jede Beschönigung, wie er als Jugendlicher in immer tiefere kriminelle Kreise geriet – und wie dieser Weg ihn letztlich ins Gefängnis führte. „Ich habe damals niemandem vertraut – und niemandem geglaubt, dass ich etwas wert bin“, erzählte er.
Sein Umzug – das Ergebnis einer bewussten Entscheidung, sein bisheriges Leben hinter sich zu lassen, und intensiver Bemühungen, aus dem geschlossenen Strafvollzug ins Seehaus Leipzig zu wechseln – wurde für ihn zu einem echten Wendepunkt. Plötzlich fand er sich in einer Hauselternfamilie wieder, saß am selben Tisch mit deren Kindern, lernte erneut, pünktlich aufzustehen und Verantwortung zu übernehmen. Dinge, die für viele selbstverständlich sind, waren für ihn völliges Neuland: gemeinsam Feste feiern, Konflikte ohne Gewalt lösen, anderen zuhören – und vielleicht zum ersten Mal auch sich selbst.
Auch jetzt, nach seiner Entlassung, hat Harun immer noch engen Kontakt zu „seinen“ Hauseltern und den damaligen Mitbewohnern. „Ich kann da jederzeit anrufen, und wenn ich vorbeikomme, krieg ich noch mein Lieblingsessen gemacht“, sagte er mit einem Lächeln. Dieser fortbestehende familiäre Rückhalt ist für ihn ein Anker – privat wie beruflich.
Während des Vortrages beantwortete Harun offen die neugierigen Fragen der Besucherinnen und Besucher: „Ja, es ist hart hier – vielleicht härter als im Knast, weil dich keiner in Ruhe lässt. Aber genau das hat mich rausgeholt.“ Seine ehrlichen Einblicke, gepaart mit spürbarer Dankbarkeit, gaben dem Konzept des „Vollzugs in freien Formen“ ein Gesicht – und machten deutlich, dass der Erfolg hier nicht in Zahlen gemessen wird, sondern in gelebten Veränderungen.

Ein Fazit, das nachdenklich macht
Als wir das Seehaus Leipzig verließen, waren sich viele einig: Dieses Konzept verdient mehr Unterstützung und Anerkennung. Es zeigt, dass Resozialisierung mehr sein kann als bloße Verwahrung. Es beweist, dass auch schwierige junge Menschen eine zweite oder dritte Chance verdienen – und sie diese oft besser nutzen, als wir es für möglich halten.
Die Frage, die bleibt: Warum nutzen wir dieses erprobte Konzept nicht stärker? Warum bleiben sieben Plätze unbesetzt, während andernorts über Überfüllung in Gefängnissen geklagt wird? Vielleicht braucht es mehr Mut von uns allen – von Richtern, Staatsanwälten, Behördenleitern – um neue Wege zu gehen.
Das Seehaus Leipzig zeigt: Es geht auch anders. Menschlicher. Wirksamer. Hoffnungsvoller. Wann fangen wir an, diesen Weg konsequent zu beschreiten?
Haben Sie Interesse, das Seehaus Leipzig selbst kennenzulernen? Führungen und Informationsveranstaltungen sind möglich. Kontakt: sachsen@seehaus-ev.de